Das Kunsterlebnis im neuro-biologischen Zeitalter

Giotto, "St. Franziskus predigt den Vögeln",
um 1295
Kürzlich, in der Tate Gallery vor Stanley Spencers „Saint Francis and
the Birds“, erlebte ich die exorbitante Performance eines
Museumsbesuchers, dessen Versuch nämlich, den himmelwärts gerichteten
Blick und die akrobatisch verdrehten Arme und Beine des Heiligen, die
das anwesende Federvieh mehr als alles andere zu beeindrucken scheinen,
nachzuahmen:
Ein Anblick für die Götter, und das bei freiem Eintritt! Hatten ihm
seine „mirror neurons“ einen Streich gespielt oder karikierte er
hochbewußt die durchs Kunsterlebnis ausgelöste Zustandsveränderung?
| Stanley Spencer, "St. Francis and the Birds" |
| Link zum Bild |
Zu den wenigen Überraschungen der letzten documenta
zählte ein die Auswahlkriterien betreffendes Aviso der Kuratorin Ruth
Noack. In einer Kunstzeitungs-Kolumne (9/2006) gab sie bekannt, wichtig
sei ihr die Verführung zu unerwarteten Einsichten, bei denen die
beglückende Beziehung zwischen Betrachter und Kunstwerk auf einer
anderen Gewißheit als der des Altbekannten fuße. Bemerkenswert an dieser
Verlautbarung war nicht deren nahezu 100%-ige Folgenlosigkeit, sondern,
daß sie überhaupt öffentlich formuliert wurde, und zwar von einer –
temporär zumindest – exponierten Figur der Kunstszene.
Damit war ein spezifischer Modus der Kunstrezeption
angesprochen, der seit dem 18. Jahrhundert als ästhetisches Erlebnis
(Baumgarten) firmiert, im 19. Jahrhundert unter der Bezeichnung
Kunsterlebnis volkstümlich wurde, aber im aktuellen Diskurs schon
seit den 70er Jahren keine Rolle mehr spielt. Zwar offeriert die
Tourismusindustrie, fasziniert von der noch immer nachwirkenden Aura des
Begriffs, das generationsübergreifende, spezielle, hautnahe, delikate,
ultimative Kunsterlebnis. Selbstverständlich binden Museen, Messen (Art
Cologne: „Kunsterlebnis pur“) oder Großveranstaltungen wie die documenta
die offenbar vielversprechende Vokabel in ihre Marketing-Strategien ein.
Tatsächlich aber – das
vermitteln Katalogtexte, Exponate und Ausstellungsdesign des Kasseler
Events – zielen avancierte Kuratoren, wenn sie zum „Bespielen“ antreten,
auf nichts weniger ab als auf eben dieses Erlebnis. „Theorie-Karaoke“
(Pierangelo Maset) steht entschieden höher im Kurs. Selbst eine
Ausstellung wie die „Über Schönheit“ (2005) im Berliner Haus der
Kulturen hatte ausdrücklich nicht die „sinnliche Reaktion des
Betrachters auf ´schöne Bilder´“, also ein Kunsterlebnis im Blick,
vielmehr ging es darum, den Begriff Schönheit – so der Kurator Wu Hung
aus Chicago – „als ein Feld für Problematisierungen in der Produktion
und in der Würdigung heutiger Kunst“ neu zu fassen.
Weitgehende Zurückhaltung auch bei Kunst- bzw. Bildwissenschaftlern: Versuche etwa, den Begriff neu zu konnotieren, sind rar, beschränken sich bislang auf relativ wenige Arbeiten, die den Ausstellungsbetrieb nicht erreichen. Interessant ist in dem Zusammenhang der Hinweis Hans Ulrich Gumbrechts am Schluß seines Essays Epiphanien, er habe sich, um Mißverständnissen vorzubeugen, daran gewöhnt, einen bestimmten, durch das ästhetische Erleben ausgelösten Zustand mit einer umgangssprachlichen englischen Redewendung (to be in synch with the things of the world) zu charakterisieren.
Die eigens angehängte Fußnote, er reagiere mit der Erläuterung des Ausdrucks „in Einklang sein“ auf den Einwand eines Kollegen, verführt zu der Vorstellung, es stünden hier mehr als nur Begriffsklärungen zur Debatte: Offensichtlich existiert neben der Venustraphobie, der Angst vor schönen Frauen, die Angst vor den Schönen Künsten, vor dem Kunsterlebnis.Was Dürer über die Schönheit feststellen mußte, daß
er nicht wisse, was das sei, wiewohl sie vielen Dingen anhänge, dürfte
auch für das Kunsterlebnis gelten. Wer also hier definiert, macht sich
zum Narren: Ausgelöst wird es durch komplexe, via Gestalt formulierte
Mitteilungen über ästhetisches Erleben; über Bilder also, die bestimmte
intensive Momente fixieren, in denen das Gefühl des In-der-Welt-Seins
kurzfristig alle anderen Empfindungen und Vorstellungen
überlagert. Gebunden an das dargestellte Motiv kommt über die Formgebung
ein abstraktes Element ins Spiel, das die konkrete Erscheinung mit
Ingredienzien der Transzendenz auflädt. Der Betrachter kann die
spezifische, jedwede Alltagsanmutung der Dinge übersteigende Faszination
ad hoc nicht analysieren, aber – die Form scheint unmittelbar auf den
Stoffwechsel einzuwirken – intuitiv spüren: als eine Art fortlaufendes
Vibrieren zwischen entfachter Sehnsucht und ihrer Beruhigung durch das
Bild. Oder anders gesagt: Man möchte im Bild bleiben und zugleich die
physischen Gegebenheiten der dargestellten Situation hinter sich lassen,
dem näher kommen, was das Kunstwerk verspricht.
Aussagen über psychische Vorgänge dieser Art machte
bereits Pythagoras im 6. vorchristlichen Jahrhundert. In einem von
Diogenes Laertios überlieferten Text vergleicht er das Leben mit einer
Festversammlung: „Die einen kommen zu ihr als Wettkämpfer, die anderen
des Geschäftes wegen, die besten aber als Zuschauer.“ Hier also werden
erstmals jene Individuen aktenkundig, die – wie man später sagen wird –
eine ästhetische Haltung einnehmen. Nach Aristoteles folgt dieser
Haltung ein Erlebnis intensiver Lust, das aus dem Schauen und Hören
geschöpft ist und er fügt hinzu, diese Lust sei so stark, daß sich der
Mensch kaum davon losreißen könne.

Im Kern ist damit fixiert, was noch immer das
Zentrum diesbezüglicher Definitionen ausmacht: die emotionale
Komponente. Und selbst für den gegenwärtig erforderlichen Appell an den
Diskurs, den Gehalt ästhetischer Wahrnehmung – auch wenn er begrifflich
nicht zu fassen ist – wieder als sinnvolle Gegebenheit zu akzeptieren,
gäbe es Hilfestellung bei Aristoteles. Er spricht von der
„Namenlosigkeit des Sinnlichen, das sich nennt, indem es sich zeigt“.
Desgleichen läßt sich seine Vorstellung, jene intensive Lust stamme aus
den Eindrücken selbst, mittels neuerer Befunde der Neuro- und
Evolutionswissenschaften bestätigen.
Zuvor eine kurze Reminiszenz an einen Top-Terminus
der Ästhetik-Debatte des ausgehenden 19. Jahrhunderts: „Mudi würde im
Boot liegen und Wasserrosen (...) aus dem schlammigen Erdreich ziehen,
oder über Einfühlung reden, das war ja jetzt so ein Schlagwort.“ Der
Satz entstammt der 1910 erstmals veröffentlichten Erzählung „Glück in
Dornen“ von Irene Forbes-Mosse, einer Enkelin Bettina von Arnims und
zeigt, daß „Einfühlung“ zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch außerhalb
akademischer Gefilde en vogue war. Begonnen hatte die Karriere des
Begriffs im 18. Jahrhundert. Neben Herders Formulierung
– „Ein Mensch, der stark in sich selbst ist, fühlt sich nur in
weniges, aber sehr tief hinein “(1774/78) –
war es dann vor allem Novalis´ legendäre Sentenz aus dem posthum
gedruckten Romanfragment „Die Lehrlinge zu Sais“ (1802), die jene
romantische Aktivität reüssieren ließ und mit einem Etikett versorgte:
„So wird auch keiner die Natur begreifen,
(...) der nicht (...)
sich gleichsam in sie hineinfühlt.“ Der Sprung zum substantivierten Verb
gelang mit Robert Fischers Dissertation „Über das optische Formgefühl“
(1873).
Wie kommt der Ausdruck in die Dinge? In
Beantwortung dieser Kardinalsfrage konstatiert er „ein unbewußtes
Versetzen der eigenen Leibform und hiermit auch der Seele in die
Objektform“ und fährt fort: „Hieraus ergab sich mir der Begriff, den ich
Einfühlung nenne.“ Bei Theodor Lipps schließlich avanciert „Einfühlung“
zum Schlüsselbegriff einer psychologisch fundierten Ästhetik-Theorie.
Quintessenz: Ästhetisches Erleben ergibt sich, wenn der Betrachter seine
psychische Aktivität auf ein fokussiertes Objekt überträgt.
Interessanterweise erscheint 1875, zwei Jahre
nachdem Robert Vischer seine Dissertation veröffentlicht hatte, mit
Hermann Siebecks „Das Wesen der ästhetischen Anschauung“ eine Arbeit,
die zu gänzlich anderen Ergebnissen kommt. Während die
Einfühlungstheorie in der Aktivität des Subjekts und dessen
„Selbstversetzung ins Objekt“ (Heinrich Wölflin) den Ausgangpunkt für
ästhetisches Erleben sieht, drehen sich die Verhältnisse in der von
Siebeck vertretenen Kontemplations-Theorie um: Die Aktivität –
Schopenhauer spricht vom Entgegenkommen der Natur – liegt beim Objekt;
der Betrachter, der sich vom Objekt „erfüllen läßt“, „zu seinem Spiegel
wird“, bleibt passiv. Nicht nur
das letzte Zitatfragment legt nahe, von dieser Position aus eine Brücke
zu den Spiegelneuronen, den
aktuellen Hätschelkindern der Neurobiologie und Neuropsychologie zu
schlagen.
Nachdem 1992 das Team um Giacomo Rizzolatti im
Prämotorischen Kortex von Makaken auf bestimmte Nervenzellen gestoßen
war, die auch dann feuerten, wenn nicht der Proband selbst, sondern der
Experimentator nach der vielzitierten Erdnuß griff und diese Entdeckung
1996 unter der Bezeichnung „Affen-Spiegel-Neuronen“ über zwei Artikel in
die wissenschaftliche Welt entlassen hatte, gerieten „Nachahmerzellen“
relativ schnell in den Fokus wissenschaftlicher Aufmerksamkeit, was
Rizzolatti später mit leichter Ironie kommentierte, denn bis dahin hatte
sich die Neurophysiologie primär für „höhere“, d.h., für Kognition,
Geist und Bewußtsein zuständige Neuronenfelder interessiert und jene
Zentren, die „nur“ einfache Bewegungen auslösen, stark vernachlässigt.

Als später William Hutchinson die Spiegelneuronen
auch bei Menschen nachweisen konnte (1999) und ihre Relevanz u.a. für
Partnersuchende, Physio- und Psychotherapeuten, Pädagogen, Logopäden und
Dentisten („Mit Spiegelneuronen gegen Zahnarztangst“) kaum noch in
Zweifel steht, würde man – so die Vermutung – auf
ihre Etablierung in Bereichen der
Kunst nicht allzu lange warten müssen, zumal das System der
Spiegelzellen als Erklärungsmodell für Intuition anderen Vorstellungen –
Enterisches Nervensystem („Bauchgefühl“), Damasios
„Als-ob-Körperschleife“ – den Rang abzulaufen scheint. Was durchaus von
Belang ist, da Intuition als das konstituierende Element
künstlerischer Produktion und deren Rezeption gilt.
Vorerst allerdings gibt es nur wenige konkrete
Hinweise: Daß Nachahmerzellen bei der Wahrnehmung von Tanzdarbietungen
eine Rolle spielen, beim Zuschauer also die gleichen Hirnareale
aktivieren wie beim Tänzer, ist nicht überraschend („Journal of
Neuroscience“ Dezember 2006). Bewegt sich dagegen ein Roboter,
unterbleibt die Nervenentladung. Was aber passiert angesichts einer
bildhaften Darstellung? In einem Vortrag über „Neuronale Rezeption
emotionaler Inhalte der darstellenden Kunst“ beschreibt Hans Hacker den
Informationsfluß, der schlußendlich den hier zunächst interessierenden
Effekt bewirkt: Die dem Ausdruck des Bildes eingeschriebenen Emotionen
evozieren unmittelbar und unbewußt eine Erregung, die im Mandelkern
(Sitz der Gefühle) aufgenommen wird. Während daneben die über mehrere
Neuronenstationen laufende Umwandlung des von der Netzhaut erfaßten
visuellen Reizes in eine Wahrnehmung erfolgt, geht zugleich ein
Informationsstrom zum Scheitellappen, der dort – im diesbezüglichen
Abstrakt sind die Spiegelneuronen ausdrücklich genannt – den Impuls zur
Nachahmung der dargestellten Körperhaltung auslösen kann.
Inzwischen wurden interne Simulationen auch bei
Wahrnehmungen registriert, wo es um innere Bewegung geht.
Christian Keysers vom Neuro-Imaging Center in Groningen stieß auf
neuronale Erregungen im Insularen Kortex, und zwar ebenfalls dann, wenn
Testpersonen Gefühle wie Angst, Freude, Ekel in filmischer Darstellung
beobachteten. Keysers vermutet Spiegelzellen auch in anderen Bereichen
des Gehirns und geht davon aus, daß sie die gesamte Palette
wahrzunehmender Empfindungen imitieren können. Vermutlich also nehmen
Künstler – intensiver offenbar und umfassender als dies bei Erwachsen
normalerweise der Fall ist – mit Hilfe der Spiegelneuronen das
Grundbefinden eines Gegenübers sowie dessen aktuelle Gestimmtheit
intuitiv wahr. Und sie erleben diese gefühlsunterlegte Erfahrung – hier
durchaus Kindern vergleichbar – als einen
Erkenntnisakt von höchster Bedeutung. Nicht zufällig gehören
Sätze wie „Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt
darin, als Erwachsener einer zu bleiben.“ (Pablo Picasso) oder „Kunst
ist nichts anderes als der Versuch, die Intensität frühester Erfahrungen
wiederzugewinnen.“ (Henry Moore) zum Zitatenfundus des 20. Jahrhunderts.
Zweifellos aber führt auch bei Künstlern nicht automatisch jeder optische Input zur Ausschüttung dopaminerger Neurotransmitter, d.h., zur Belohnung durch Lustempfindung, mit der die Evolution, so heißt es, „nützliche“ Aktivitäten ihrer Organismen auszeichnet. Anders gesagt: Nicht sämtliche Kontakte mit fremder Innerlichkeit ergeben zwangsläufig ein attraktives Sujet. Ob eine wahrgenommene Person zum Motiv wird, hängt ab von den neuronalen Verschaltungsmustern, den inneren Bildern des betreffenden Künstlers und der Art und Weise, wie diese Person in Erscheinung tritt. An dem Punkt greift der für Künstler überaus wichtige V-Effekt: Während die eintreffenden Sinnesreize – so die Vorstellung moderner Neurobiologen – im Kortex ein Wahrnehmungsbild entstehen lassen, wird in anderen Arealen der Hirnrinde, ausgehend von vorhandenen Einprägungen, ein Erwartungsbild aufgebaut. Keine Reaktion erfolgt, wenn beide Muster übereinstimmen oder total divergieren. Abweichungen dagegen evozieren neuronale Aktivitäten, die sich dem Wahrnehmenden via Gefühl vermitteln: Irritation verbunden mit leichter Erregung. Die minimale Abwandlung – an der Ampel: der knallrote Reflex auf dem Gesicht einer Frau – bewirkt eine Verfremdung des Vertrauten, die zu gesteigerter Aufmerksamkeit führt. Das Wahrgenommene löst sich kurzfristig (zwei Sekunden später „kommt“ grün!) aus dem pragmatischen Kontext, gerät in die Perspektive des Ästhetischen und könnte, aufgeladen mit sinnlichem Sinn, eine bildnerische Klärung, d.h. Formulierung des Phänomens motivieren.

Sollten Spiegelneuronen auch an Gefühlsaufwallungen
vor Bergwiesen und Moorkuhlen
beteiligt sein? Oder kommen solche Empfindungen – und damit die
Verdichtung einer Wahrnehmung zum Motiv – über neuronale Resonanzen
anderer Nervenzellen zustande? Wie auch immer: Dem Landschafsmaler Bernd
Schwering z.B. gibt sich, wie er im Apex-Interview Nr.1 mitteilt, ein
Motiv so zu erkennen: „Dann plinkt´s oben!“
Die Zündung eines
Neuronenblitzes ? Vermutlich ist das „Plinken“ hier auch dem
erwähnten V-Effekt zuzuschreiben, denn Schwerings um die Zeit (1973)
entstehende „Vorbeifahrlandschaften“, in denen, gänzlich unerwartet,
Strommasten und Verkehrsschilder etc. im Vordergrund zu Schlieren
verwischt erscheinen, Rübenmiete, Bäume und Büsche im Fond des Bildes
dagegen relativ deutlich dargestellt sind, entsprechen geradezu
idealtypisch der Abweichung vom etablierten Schema. Entfalten aber kann
sich diese Situation nur auf der Basis einer spezifischen
Subjekt-Objekt-Beziehung, aufgrund also eines bestimmten
Einwirkungspotentials der Landschaft und der entsprechenden
Disposition seitens des Empfängers.
Was die Wirkung der Dinge, der Außenwelt generell
und die gegenwartsnahe Beschreibung seiner wesentlichen Komponenten
betrifft, so findet sich bei dem englischen Lyriker Gerard Manley
Hopkins (1844-1889) eine erstaunliche
– poetisch fundierte – Vorwegnahme. In seinen Tagebüchern stößt
man auf die von ihm neugeprägten Termini „inscape“ und „instress“. Folgt
man der Interpretation Wolfgang Clemens, dann bezeichnet „inscape“ den
in der Gestalt ausgedrückten Wesenskern eines Dinges, während mit
„instress“ die Fähigkeit des Objekts gemeint ist, über diese Gestalt auf
das Subjekt einzuwirken. Jakob von Uexküll spricht in vergleichbarem
Zusammenhang von „Wirkmalen“ und „Wirkzeichen“. In modifizierter Diktion
sind beider Vorstellungen nach wie vor im Gespräch. So konstatierte
Adolf Portmann als Quintessenz langjähriger Forschungsarbeit, die Natur
bringe als primäre Qualität Ausdruck hervor. Der Biologe Andreas Weber
vertritt mit Verweis auf
Aristoteles, für den die morphologische Form eines Lebewesens dessen
anima war, die These, im Äußeren eines Organismus manifestiere sich
seine innere Grundbefindlichkeit. Und
Hartmut Böhme konstatiert, daß Natur in den Dingen eine Sprache
mit sich führe, wobei zur Ergänzung
Jaak Panksepp (er entdeckte, daß Ratten beim Spielen zirpen,
d.h., lachen!) zu nennen wäre, der die Buchstaben dieser Sprache als
eine Erscheinungsform der Materie sieht, die einen für Lebewesen sofort
lesbaren emotionalen Wert vermitteln.
Grundmuster oder Urbilder“. In den dabei wirksamen inneren Bildern
(Verschaltungsmustern, Repräsentationen) sind offensichtlich Präferenzen
gespeichert; nicht für bestimmte Naturdinge oder Artefakte, sondern für
bestimmte Modi ihrer Erscheinung. So reagieren Künstler je nach
Konditionierung primär auf
kräftige oder gedeckte Farben, auf grafische Elemente, prägnante
Hell-Dunkel-Effekte, extreme Plastizität, Komplementär-Kontraste etc.
oder eben auf die höchst animierende Ansammlung differenziertester
Texturen, wie sie das erwähnte Unkraut-Areal offeriert.
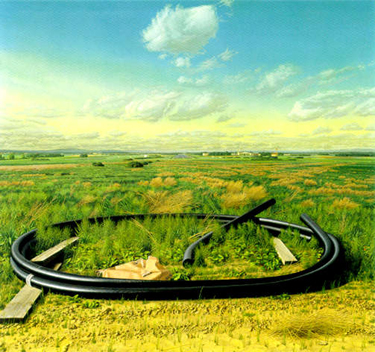
Wie entstehen diese inneren Bilder, wodurch
erhalten sie ihre individuell-spezifische Strukturierung? In
rudimentärer Form existieren sie ab ovo und ihr Ausbau, ihre
Modifikation und Neugestaltung setzt bereits im pränatalen Stadium ein;
zunächst evoziert durch Reize aus dem Mutterleib, später durch
Informationen aus der Umwelt. Relativ sicher ist, daß sich die für
ästhetische Wahrnehmung relevanten Muster zwischen dem 3. und 5.
Lebensjahr konstituieren, im Verlauf der entscheidenden Phase
organischer Gehirnreifung also, in der das neuronale System eine
besondere Offenheit in Bezug auf Erweiterung und Variation bereits
angelegter Erwartungsbilder erkennen läßt. Zum Prozeß des
Zustandekommens der individuellen Matrix gibt es verständlicherweise
keine wissenschaftlichen Reihenuntersuchungen, aber es gibt
Künstleräußerungen über den Ort des Geschehens sowie die besonderen
Umstände und atmosphärischen Gegebenheiten, wobei nie der Hinweis auf
dabei auftretende sehr spezifische Gefühle fehlt. Unbeantwortet
indessen, bislang jedenfalls, bleibt die Frage, weshalb diese
frühkindlichen, die spätere Produktion eines Künstlers wesentlich
mitbestimmenden Einprägungen – ob sie via einmaliges Ereignis oder
schrittweise erfolgen – einer möglichen Fragmentierung oder
Umstrukturierung entgehen. Gilt das beschriebene Procedere
„Wahrnehmungsbild → Erwartungsbild → Abgleich → neues, erweitertes
Erwartungsbild“ nur für pragmatisches Sehen (ich achte auf die Pfütze,
damit ich keine nassen Füße bekomme!), bedingt auch für sinnliche
Wahrnehmungen (der schillernde Ölfleck, die Spiegelung der Wolken auf
der Wasseroberfläche!), keinesfalls aber für den exzeptionellen Moment
ästhetischer Wahrnehmung, der dem Kind, begleitet von einer
„Meta-Emotion“ unterschwellig aber einprägsam vermittelt, in welchem
Erscheinungsmodus die Dinge der Welt speziell ihm den ultimativen
Zugang, das Erlebnis ihrer Evidenz, ihrer Schönheit anbieten? Dieter
Asmus: „Dieses Zentral-Erlebnis ist wie ein Haustürschlüssel: Wenn man
an ihm rumändert, paßt er nicht mehr ins Schloß.“
Geht man von einem vergleichbaren persönlichen
Ereignis wie der „ersten Liebe“ aus, dann erfolgt die Speicherung der
neuronalen Korrelate von Vorgängen derartiger Qualität offenbar in
Bereichen des Großhirns, wo sie von „alltäglichen“ Wahrnehmungsbildern
kaum tangiert werden. Ob es sich um „Flashbulb Memories“
(„Blitzlicht-Erinnerungen“), handelt – die momenthafte Modellierung der
individuellen Matrix deckt sich, bezogen auf die charakteristischen
Elemente, mit der landläufigen Definition des Begriffs – oder um die
sukzessive Ausbildung des Musters, das sich über wiederholtes Erleben
der betreffenden Wahrnehmungssituation schließlich als komplexes
Reizschema dauerhaft einbrennt: in jedem Fall scheinen diese inneren
Bilder ins autobiografische Gedächtnis zu geraten, jenen Teil des
episodischen Langzeitgedächtnisses, in dem Erinnerungen an spektakuläre
persönliche Ereignisse dauerhaft repräsentiert sind. Ins Auge
fällt, daß sie sich auch dann in allen Facetten vergegenwärtigen, wenn
nur bestimmte Elemente des entsprechen Musters – durch einen visuellen
oder gustatorischen Reiz etwa – berührt werden (Prousts Madeleines). Der
nächtliche Parkplatz und die im Licht der Mastleuchen aufscheinenden
Lastwagen beispielsweise, von Altmeppen wahrgenommen Mitte der 70er
Jahre, laden sich über die Aktivierung des Urmusters mit den
konnotierten Emotionen auf, werden zum Motiv "Heiligengeistfeld", obwohl von der ursprünglichen Situation (Junigarten im
Morgenlicht vor dunkler Hauswand), die der Künstler als Kind erlebte,
nur zwei Komponenten im Spiel sind.

Expressis verbis ist dieser Sachverhalt bislang
nicht formuliert, aber aus neurologischer Sicht wären solche
Bewußtseinsvorgänge wie das ästhetische Erleben, in denen Landschaften,
bestimmte Ding- oder Figurenkonstellationen etc. zum Motiv werden, wohl
den „Metarepräsentationen“ zuzuordnen, d.h., Verschaltungsmustern
höherer Ordnung, durch die das Gehirn seine aktuelle Befindlichkeit
abbildet. Nach Antonio Damasio geht es bei der Produktion dieserart
Vorstellungen um Fabrikationen des von ihm sogenannten
„Drittkraft-Komplexes“, konkreter, um Darstellung von Reaktionen auf
Reaktionen; auf Veränderungen von Mustern also, die durch neu ins
Blickfeld geratene Objekte ausgelöst werden.
Metarepräsentationen lassen sich nicht lokalisieren, sondern
existieren als nichtlokale dynamische Gebilde, die Areal übergreifend
als synchrone Zustände von Millionen verteilter Nervenzellen in
Erscheinung treten (Wolf Singer). Von entscheidender Bedeutung für die
Synchronisation sind – dem
Modell des Bremer Neurobiologen Hans Flohr zufolge – die sog.
NMDA-Synapsen der Hirnrinde. Sie ermöglichen die Kreation komplex
strukturierter neuronaler „Assemblies“, die Zustände ästhetischer
Begeisterung spürbar machen.

Worauf aber bezieht sich diese Begeisterung? Was
ist die Essenz jener wortlosen Botschaften, die den Künstler
veranlassen, ihre Evidenz via Kunstwerk zu „beweisen“? Im Werk des
englischen Schriftstellers W.H. Hudson – er verlebte seine Kindheit in
den Pampas Argentiniens – ist von solchen Momenten mehrfach die Rede und
das folgende
Erinnerungsbild, erstmals 1931 veröffentlicht, deutet an, worum es dabei
geht: „Im Januar im rostbraunen
Gras auf dem Rücken liegen und hochstarren an den weiten, heißen,
weißblauen Himmel, der von Millionen und Myriaden schimmernder, immer
und ewig vorbeitreibender Kugeln von Distelwolle bevölkert ist; starren
und starren, bis sie für mich lebende Wesen sind und ich, in einer
Verzückung, mit ihnen bin, treibend in dieser gewaltigen leuchtenden
Leere!"
Von einem vergleichbaren Moment berichtet der
Zeichner (und Maler) Fritz Koch. Hier löste ein zwischen Aller und Acker
liegender flacher, sumpfiger Tümpel – sein bevorzugter „Spielplatz“ –
einen bis heute nachwirkenden Impuls aus. Er sucht ähnlich
geartete Habitate auf, nimmt Maisstauden, Boviste, Tierkadaver ins
Atelier, um zeichnend den Moment zu ermitteln, in dem die von ihm
erwartete Resonanz, das Gefühl nämlich einer „tief empfundenen
Übereinstimmung“, spürbar wird. Koch spricht in dem Zusammenhang von
glücklichen Augenblicken der Kongruenz, die sich einstellen, wenn
im Zuge der Arbeit erste Details seiner minutiös gezeichneten
Imaginationen „flächendeckender Urzustände“ Gestalt annehmen.

Erwartungsgemäß knüpft ein Resümee bei den
Bemerkungen zur Kogenese und Koevolution an: Charakteristisch für
Ereignisse dieser Kategorie scheint zu sein, daß der Betrachter im
höchsten Maße bei sich und zugleich außer sich ist. Seine Aufmerksamkeit
gilt sowohl der Epiphanie der Dinge als auch den endogenen Bildern.
Ästhetische Euphorie – erlebt
als innere Turbulenz oder elementare Beruhigung – stellt sich in
dem Moment ein, wo beide Ebenen paßgenau in Deckung sind. Es wird bewußt
und als unbezweifelbar erlebt, daß etwas (von Bedeutung) außerhalb der
eigenen Person existiert, wofür es in dieser Person eine
Entsprechung, eine Matrix gibt: Ein zeitlich begrenzter, offenbar höchst
befriedigender Zustand, der als eine die gesamte Person durchdringende
Erfahrung jener von Tieck angesprochenen Verwandtschaft zu spüren ist –
beglaubigt durch Zuteilung der genannten
Neurotransmitter.
Der Psychologe und Philosoph Müller-Freienfels konstatierte bereits
1912, daß solche „Gewißheitsmomente“ jedem Kind, auch noch dem
Erwachsenen widerfahren könnten, aber – da sie verdrängt würden oder die
„Vorbereitung zur Ausnützung“ fehle – selten eine künstlerische
Tätigkeit in Gang setzten. Dabei ist es bis heute geblieben: Wie sollten
auch jene „augenblickslangen Zustände einer unbeschreiblichen inneren
Erhebung und Begeisterung“, von Unbeteiligten eher als Abständigkeit
klassifiziert, zu etwas Vernünftigem führen, zumal dem Kandidaten in der
aktuellen Situation weder eine goldene Nase wächst noch der Heilige
Lucas leibhaftig neben ihn tritt? Auch das Ambiente – visuelle
Sensationen herkömmlicher Art sind kaum im Spiel – gibt dem
Außenstehenden keinerlei Anhaltspunkte, wird übersehen oder als banal
registriert! Aber genau diese Diskrepanz zwischen einer bestenfalls
indifferenten Haltung des Umfeldes und der subjektiven Hochschätzung
jener „Banalitäten“ hinterläßt, das wird von Künstlern häufig betont,
einen Stachel, dessen unterschwellige Wirkung schließlich doch die
„Vorbereitung zur Ausnützung“, d.h., erste Versuche, sich der Dinge (der
Welt) zeichnend zu vergewissern, anstoßen, den Start zu einer
künstlerischen Tätigkeit initiieren kann.
Irgendwann schließlich, zu Beginn der
Professionalisierung, kommt das o.a. „aktuelle Erlebnis der
individuellen Grundmuster oder Urbilder“ zustande: Die von Dürer
sogenannte „inwendige Figur“ wird bewußt und zum Bezugspunkt für die
weitere künstlerische Entwicklung. Dabei geht es zuallererst um die
Klärung der Formfrage, die laut Kandinsky jeder nicht nachempfindende
Künstler individuell bewerkstelligen muß. Der 20-, 22-jährige
Kunststudent, der zwar genau weiß, was er nicht will, darüber hinaus
jedoch nur vage Vorstellungen zur Form seines zukünftiges Bildes
hat, nimmt zunächst – so könnte sich die Geschichte fortsetzen – die
aktuellen, am Markt befindlichen Installationen, Maler- und
Bildhauereien etc. in Augenschein, unterzieht sie gewissermaßen einem
Resonanz-Test, um so einen Anknüpfungspunkt zu finden. Von Künstlern, zu
denen eine gewisse Affinität besteht, übernimmt er bestimmte
Formelemente, modifiziert und ergänzt sie in fortwährendem Kontakt zu
seinem inneren Bild, bis endlich Arbeiten mit wachsendem Eigenanteil
entstehen und sichtbar wird, was man üblicherweise als „persönlichen
Stil“ oder „individuellen Ausdruck“ bezeichnet.
Damit liegt sie vor, die als Landschaft, Stilleben
oder Porträt präsentierte Mitteilung über einen intensiven Augenblick
sinnlicher Wahrnehmung: Manifestation einer das alltäglich-pragmatische
Wiedererkennen hinter sich lassenden Sicht der Dinge und zugleich
Offerte an potentielle Rezipienten, via Betrachtung in ein Kunsterlebnis
einzusteigen. Daß es nicht zwangsläufig vor jedem Kunstwerk passiert
oder oft nur als kurzer, sich schnell verflüchtigender Anhauch
registriert wird, hängt u.a. mit den individuell unterschiedlichen
Einprägungen im biographischen bzw. emotionalen Gedächtnis zusammen. Daß
es prinzipiell möglich ist, angesichts eines Bildes, einer Zeichnung
oder Plastik für Momente mit den Dingen der Welt in Einklang zu geraten,
wird verständlicher, wenn man Tiecks Gedanken zur verwandtschaftlichen
Beziehung zwischen Pflanze und Mensch um neuere Einsichten erweitert:
Natur und Kultur gehören derselben Semiosphäre an.
In beiden Bereichen erfolgt der Informationsaustausch auf identische
Weise, und zwar per Symbol, genauer, per präsentatives Symbol. So wie
ein bestimmter Erregungszustand von Nervenzellen dem Bewußtsein nicht
als deckungsgleiche Abbildung serviert, sondern symbolisiert, also
übersetzt in Gefühl, mitgeteilt wird; wie auch die Katze auf
Aggression reagiert, indem sie ein Symbol „gestaltet“, nämlich den
„Buckel“ – und dergestalt ihre Anspannung eindringlich signalisiert, so
transponiert der Maler die durch ästhetische Wahrnehmung ausgelöste
Empfindung in ein aus Farbe geformtes Symbol. Es evoziert beim
Betrachter, als habe er das Motiv realiter vor Augen, eine Emotion. Das
Symbol wirkt wie reales Eingreifen; zwischen kulturellen Zeichen und
materiellen Reizen besteht hinsichtlich der Wirkung – so Andreas Weber –
kein Unterschied.
Im Prinzip ist das richtig! Damit aber ein
artifizielles Zeichen tatsächlich die Kraft und Präzision eines
organischen Ausdrucks erreicht, sollte der betreffende Künstler Form
als entscheidenden Wirkungsfaktor (am besten) intuitiv erfaßt oder
(wenigstens) begriffen und habitualisiert haben. Natürlich, irgendeinen
Effekt erzielt jedes Bild, auch wenn es nur in einer Art
Pseudo-Impressionismus die optische Erscheinung reproduziert. Ein
Kunsterlebnis indessen wird nur bei bewußt gesetzter Form eintreten, und
die wirkt in dem Maße, wie es dem betreffenden Maler gelingt, die durch
das Motiv ausgelösten Emotionen umzusetzen.

Wenn eine Katze buckelt, dann präsentiert sie das Resultat einer Reizung, ihre Anspannung nämlich, umgesetzt in symbolische Form. Das geschieht unmittelbar, von innen nach außen, wobei ihr Organismus, dem die Störung widerfährt, zugleich als Medium ihrer Performance fungiert.

Johannes Müller Franken, "Piazza Manzini", 2003
Wenn ein Künstler von der einer
Menschengruppe „anhängenden“ Schönheit erfaßt wird (Jugendliche im
Zwielicht eines Sommerabends auf einer italienischen Piazza) und diese
Ergriffenheit (Symptom einer Neu- oder Wiederempfindung des Zustands der
Kongruenz!) als Gemälde fixieren will, muß auch er, um aus Farben –
toter Materie – die gewünschte deutliche Resonanz erzeugende Form zu
bilden, von innen nach außen arbeiten. D.h., sein
Hand-Auge-Apparat materialisiert die Form bis zum letzten Pinselstrich
in permanentem Abgleich mit dem inneren Bild, was eine erhebliche
Anstrengung insofern erfordert, als dieses innere Bild – bei
gleichzeitiger Konzentration auf den Malvorgang –
präsent bleiben muß. Nur so kann der präzise Ausdruck eines
präzisen Gefühls entstehen,
wobei – das läßt sich bei Picasso studieren – die dem Augenschein
verpflichtete Ähnlichkeit durchaus zu vernachlässigen ist.
Zurück zum Ausgangspunkt: Zweifellos hängt die
phantomhafte, kaum wirklich anwesende, nicht gänzlich abwesende Existenz
des Kunsterlebnisses im aktuellen Betrieb mit der Erweiterung des
Kunstbegriffs zusammen. Durch die permanent fortschreitende
Diskursivierung der Kunst – ein Indiz: das Anhimmeln der zum Axiom
hochstilisierten „Referenz“ – kommt es zur stillschweigenden
Suspendierung der Form als dem konstituierenden Faktor der Kunst.
Wo „Form“ nur noch als sozio-kulturelles Phänomen („Migration der Form“
war ein Themenschwerpunkt der dokumenta
12) registriert, aber nicht mehr das Erlebnis seiner Wirkung angepeilt
wird, geht das Gespür für deren basale Bedeutung und damit auch für das
Rezeptionsmodell „Kunsterlebnis“ verloren. Was da verlorenginge,
erlangte volle Reputation zwar im 19. Jahrhundert, hat sich dabei als
Fixpunkt bürgerlich-elitären Umgangs mit Kunst etabliert und zu einer
Sache mit Kultstatus entwickelt, ist aber natürlich, sofern man es in
diesem Kontext beläßt, absolut unterbewertet.
Wie anders als durch ästhetisches Erleben sollte
jenes „to bee in synch...“ spürbar werden? Was sonst als Kunst könnte
diesbezügliche Erfahrungen in Ausdruck umsetzen? Und ebenso scheint es
kein Äquivalent für die per Kunsterlebnis rekonstruierbare Empfíndung
der Identität zu geben.
Im Spiegel neuerer humanwissenschaftlicher
Erkenntnisse zeigt sich zudem, daß dieser Bereich menschlicher
Kognition in elementarer Weise mit den existenzsichernden
Grundvorgängen in Fauna und Flora verflochten bzw. als deren
kulturelle Entsprechung zu sehen ist: möglicher Ausgangspunkt für
eine neue Avantgarde?
Literatur:
Joachim Küpper/Christoph Menke (Hrsg.),
Dimensionen ästhetischer
Erfahrung. Frankfurt: Suhrkamp 2003.
Thomas Friedrich/Jörg H. Gleiter (Hrsg.),
Einfühlung und phänomenologische
Reduktion. Münster, 2007
Gerald Hüther, Die Macht der inneren Bilder, Wie Visionen das Gehirn, den Menschen und die Welt verändern, Göttingen, 2004
MERKUR; Deutsche Zeitschrift fütr europäisches Denken, 2009, Heft 6 (leicht gekürzt)